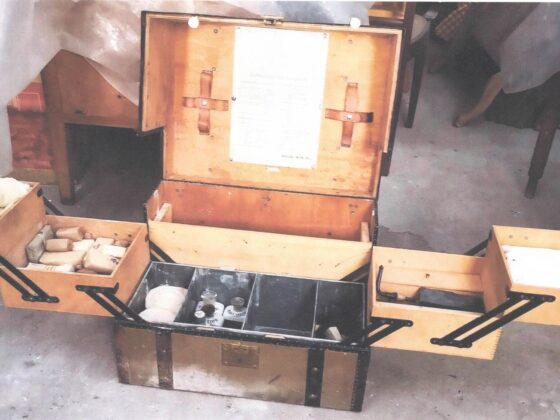Viele Menschen machen sich Gedanken über „ihr Cholesterin“. Denn hohe Cholesterinwerte im Blut können langfristig das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöhen. Das Portal Gesundheitsinformation.de berichtet darüber.

Das Online-Gesundheitsportal Gesundheitsinformation.de liefert ein breites medizinisches Themenspektrum für erkrankte sowie gesunde Bürger:innen. Krankheiten und medizinische Beschwerden werden ausführlich beschrieben, zusätzlich wird über Behandlungsmöglichkeiten informiert. Das Online-Gesundheitsportal stellt seine Inhalte Südtirols Institut für Allgemeinmedizin und Public Health zur Verfügung.
Cholesterin ist ein wichtiger Baustoff in allen Geweben des Körpers, der an vielen Stellen des Stoffwechsels benötigt wird. Dazu wird es im Blut in kleinen „Paketen“ zwischen den Organen transportiert. Es gibt verschiedene Arten von Cholesterin. Vor allem das sogenannte LDL-Cholesterin erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn viel Cholesterin im Blut ist, sprechen Fachleute von einer Hypercholesterinämie.
Denkt man über eine Behandlung nach, ist es sinnvoll, neben den Cholesterinwerten noch andere Risikofaktoren in den Blick zu nehmen. Dazu gehören zum Beispiel der Blutdruck und die Blutzuckerwerte. Erst wenn man alle Faktoren zusammen betrachtet, lässt sich das persönliche Risiko für Erkrankungen wie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall gut abschätzen. Das hilft auch bei der Entscheidung für oder gegen eine Behandlung mit Medikamenten.
Symptome
Ungünstige Cholesterinwerte verursachen normalerweise keine Beschwerden. Über die Jahre können sie aber das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Das sind zum Beispiel verengte Herzkranzgefäße, Herzinfarkte oder Schlaganfälle.
Sehr hohe, durch einen erblichen Genfehler bedingte Cholesterinwerte führen manchmal zu sichtbaren Ablagerungen unter der Haut. Typisch sind gelbliche Erhebungen an der Achillessehne oder oberhalb der Augenlider. Auch Schwellungen an den Sehnen der Hand können auf Cholesterinablagerungen hinweisen. Im Auge können Ablagerungen als ein heller Ring am Rand der Iris sichtbar werden. Viele Menschen mit genetisch erhöhten Cholesterinwerten haben aber keine Symptome.
Ursachen
Der Cholesterinspiegel hängt meist von der Lebensweise ab. Wenn ein ungesunder Lebensstil zu erhöhten Werten führt, spricht man von „erworbener Hypercholesterinämie“. Gewohnheiten, die das LDL-Cholesterin erhöhen können, sind:
- eine Ernährung mit vielen gesättigten Fettsäuren und Trans-Fettsäuren
- wenig Bewegung
Auch starkes Übergewicht geht oft mit ungünstigen Cholesterinwerten einher.

Bei Frauen kann das LDL-Cholesterin nach den Wechseljahren leicht ansteigen.
Manchmal tragen andere Erkrankungen zu erhöhten Cholesterinwerten bei. Vor allem Menschen mit Diabetes haben oft damit zu tun. Aber auch Rheuma, eine Unterfunktion der Schilddrüse, Nieren- oder Lebererkrankungen sind mögliche Ursachen. Bestimmte Medikamente können den Cholesterinspiegel im Blut ebenfalls etwas steigen lassen. Dies gilt zum Beispiel für Kortisonpräparate und HIV-Medikamente.
Manche Menschen haben eine genetisch bedingte Form von Hypercholesterinämie (familiäre Hypercholesterinämie), die von Kindheit an besteht. Dazu kommt es, wenn man von den Eltern ein verändertes Gen geerbt hat, das den Stoffwechsel des LDL-Cholesterins stört. So ein Genfehler kann zu sehr hohen Cholesterinwerten führen und unbehandelt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöhen.
Risikofaktoren
Je höher der LDL- oder Gesamtcholesterinwert ist, desto höher ist auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Risiko steigt auch, je länger die Cholesterinwerte erhöht sind: Wer bereits in jungen Jahren erhöhte Werte hat, entwickelt im Laufe des Lebens eher eine Arteriosklerose.
Wichtig ist: Zu hohe Cholesterinwerte sind nur einer von mehreren Einflussfaktoren. Nur wenn alle zusammen betrachtet werden, lässt sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gut einschätzen. Andere bedeutsame Risikofaktoren sind:
- Bluthochdruck
- Diabetes
- Rauchen
- zunehmendes Alter
- männliches Geschlecht
Das Risiko ist auch erhöht, wenn ein Bruder oder der Vater vor dem 55. Geburtstag einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatte – oder eine Schwester oder die Mutter vor dem 65. Geburtstag.
Wie hoch das persönliche Risiko ist, kann mithilfe von Computerprogrammen – sogenannten Risikorechnern – ermittelt werden. Das macht man am besten zusammen mit der Ärztin oder dem Arzt. Mit dem Ergebnis lässt sich gemeinsam entscheiden, ob sich eine Behandlung mit Medikamenten lohnt.
Häufigkeit
Erhöhte Cholesterinwerte sind relativ häufig. Das liegt auch daran, dass Ärztinnen und Ärzte die Diagnose heute bei niedrigeren Werten stellen als früher. Nach einer Studie des Robert Koch-Instituts aus dem Jahr 2010 liegt bei mehr als der Hälfte der Erwachsenen das Gesamtcholesterin über dem optimalen Wert.
Eine familiäre Hypercholesterinämie haben schätzungsweise 0,3 % aller Menschen.
Diagnose
Um die Cholesterinwerte zu bestimmen, nimmt die Ärztin oder der Arzt eine Blutprobe, die im Labor untersucht wird. Cholesterinwerte werden als Milligramm pro Deziliter (mg/dl) oder Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben. Es können verschiedene Werte ermittelt werden:
- Gesamtcholesterin: Dieser Wert gibt an, wie viel Cholesterin sich insgesamt im Blutkreislauf befindet. Ein hoher Gesamtcholesterinwert ist eher ungünstig.
- LDL-Cholesterin (LDL-C): In dieser Form wird Cholesterin von der Leber in den Körper transportiert, wo es für viele Aufgaben genutzt wird. Überschüssiges LDL-C kann sich aber in den Gefäßen ablagern. Ein hoher LDL-C-Wert ist deshalb mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Umgangssprachlich wird LDL-Cholesterin daher auch „schlechtes“ Cholesterin genannt. Neben dem LDL-Cholesterin gibt es noch weitere schädliche Varianten wie VLDL-Cholesterin und Lipoprotein (a).
- HDL-Cholesterin (HDL-C): In dieser Form wird überschüssiges Cholesterin aus dem Körper aufgenommen und zur Leber befördert. Dort wird es abgebaut und mit der Gallenflüssigkeit ausgeschieden. Welche Bedeutung der HDL-C-Wert hat, ist nicht abschließend geklärt. Ein hoher HDL-C-Wert galt lange als Schutzfaktor. Daher wurde das HDL-Cholesterin auch als „gutes“ Cholesterin bezeichnet. Eine Schutzwirkung hat sich in neueren Studien aber nicht bestätigt.
- Non-HDL-Cholesterin: Das ist das Gesamtcholesterin ohne das HDL-Cholesterin. Dieser Wert gilt als bester Vorhersagewert für die Herz- und Gefäßgesundheit, weil er neben dem LDL-Cholesterin noch die anderen schädlichen Varianten enthält. Viele Risikorechner zur Bestimmung des persönlichen Herz-Kreislauf-Risikos verwenden ihn. Alternativ wird manchmal auch das Verhältnis von Gesamtcholesterin zu HDL-Cholesterin genutzt (Gesamtcholesterin geteilt durch HDL-Cholesterin).
Außerdem werden oft die sogenannten Triglyzeride bestimmt. Sie können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ebenfalls beeinflussen, spielen bei der Risikobestimmung aber eine untergeordnete Rolle. Bei bestimmten Erkrankungen wie einer Bauchspeicheldrüsenentzündung können sie erhöht sein.
Ärztinnen und Ärzte verwenden oft bestimmte Grenzwerte, um den Cholesterinspiegel einzuordnen. Einen bestimmten Wert, ab dem das Risiko für Herzkrankheiten plötzlich steigt, gibt es aber nicht. Vielmehr gilt: Je höher zum Beispiel der LDL-C-Wert oder das Gesamtcholesterin, desto höher das Risiko für Folgeerkrankungen. Als ungünstig gilt auch, wenn das HDL-Cholesterin unter 40 mg/dl (1,0 mmol/l) liegt. Nationale und internationale medizinische Fachgesellschaften verwenden teilweise unterschiedliche Grenzwerte. Manche betrachten zum Beispiel bereits einen LDL-C-Wert ab 116 mg/dl (3 mmol/l) als zu hoch. Auch Ärztinnen und Ärzte benutzen in der Beratung mitunter verschiedene Grenzwerte.
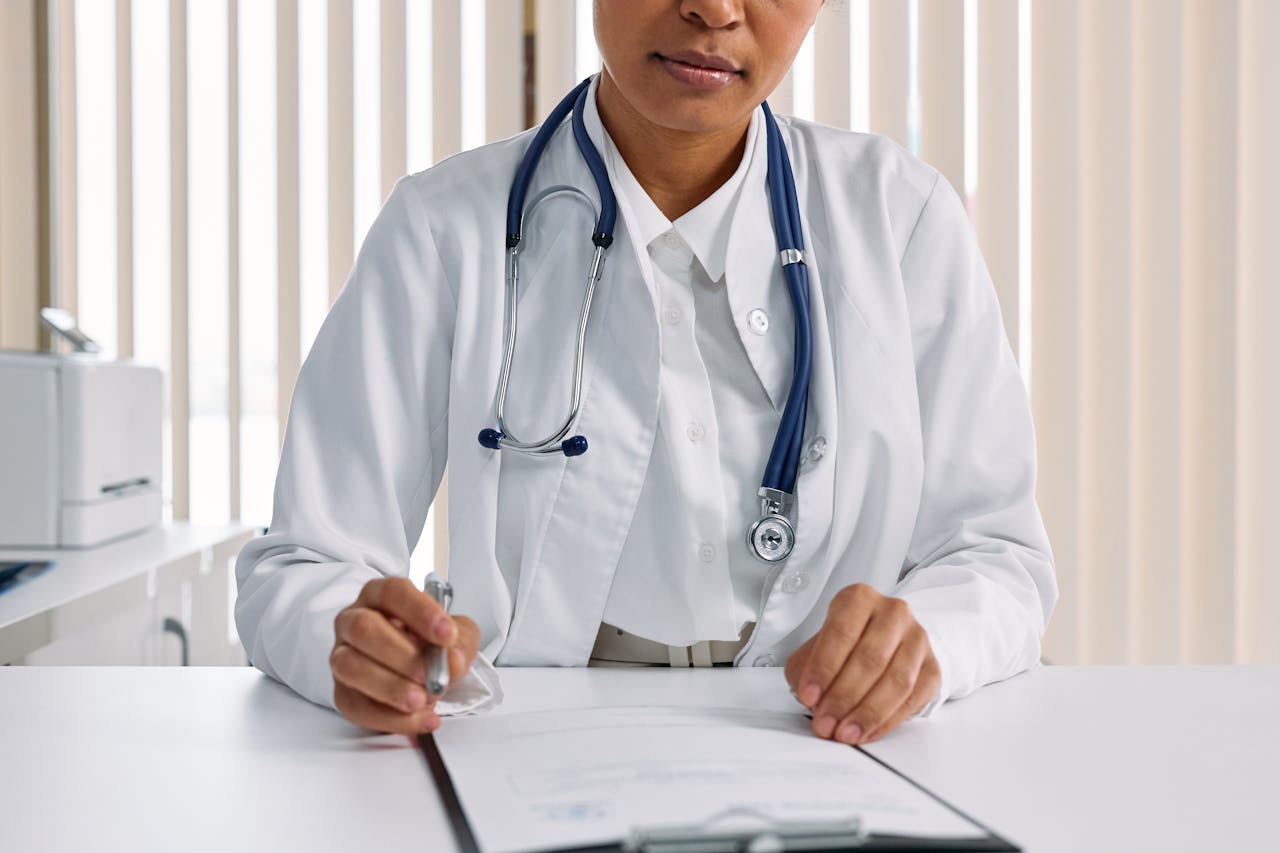
Behandlung
Grundsätzlich gilt: Ein erhöhter Cholesterinwert ist keine Krankheit, sondern einer von mehreren möglichen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei einer Behandlung geht es also nicht allein darum, die Cholesterinwerte zu senken – das Ziel ist vielmehr, die Gesundheit von Herz und Gefäßen insgesamt zu verbessern.
Gesunder Lebensstil
Man kann selbst viel gegen ungünstige Cholesterinwerte und für ein gesundes Herz-Kreislauf-System tun. Dazu gehört:
- nicht zu rauchen
- wenig gesättigte Fette und Trans-Fette zu sich zu nehmen
- sich ausreichend zu bewegen
- bei starkem Übergewicht abzunehmen
- bei gleichzeitigem Bluthochdruck: sich salzarm zu ernähren
Cholesterinsenkende Medikamente
Daneben lassen sich die Cholesterinwerte mit Medikamenten senken. Dazu werden vorrangig sogenannte Statine eingesetzt. Diese Mittel sind am besten erforscht: Sie können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachweislich senken und die Lebenserwartung verlängern. Die allermeisten Menschen vertragen sie gut.
Ob man vorbeugend Medikamente einnehmen möchte, ist eine Frage der persönlichen Abwägung. Dabei gilt: Je mehr Risikofaktoren ein Mensch hat, desto eher kann er von Medikamenten profitieren. Gemeinsam mit der Ärztin oder dem Arzt kann man ermitteln, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist, und die Vor- und Nachteile einer medikamentösen Behandlung für sich selbst abwägen.
Menschen, die bereits einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine andere Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten, haben ein hohes Risiko für weitere Herzerkrankungen. Ihnen wird deshalb eine Behandlung mit Statinen empfohlen. Dies gilt auch für Menschen mit familiär bedingter Hypercholesterinämie.
Nahrungsergänzungsmittel schützen nicht – manche können schaden
Es werden auch spezielle Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel verkauft, die die Cholesterinwerte senken und dadurch die Herzgesundheit verbessern sollen. Dass solche Mittel vor Herzerkrankungen schützen, ist aber nicht nachgewiesen: Es reicht nicht, in Studien zu zeigen, dass ein Mittel die Cholesterinwerte verbessert. Entscheidend ist, dass es das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt – und das muss in einer aussagekräftigen Studie nachgewiesen werden.
Für Fischöl-Kapseln mit Omega-3- oder Omega-6-Fettsäuren gibt es sogar Hinweise, dass sie bestimmte Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern) wahrscheinlicher machen. Deshalb raten manche Fachleute inzwischen von solchen Mitteln ab.
Entscheiden
Was man bei erhöhten Cholesterinwerten und zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen tun möchte, ist eine persönliche Entscheidung. Wie hoch ist mein persönliches Risiko und welches Risiko ist für mich akzeptabel? Wie stark möchte ich mein Leben umstellen und kommen Medikamente für mich infrage? Manche Menschen möchten eine Behandlung und Lebensstilanpassung möglichst einfach halten. Andere möchten ihr Risiko möglichst stark senken, auch wenn es mehr Aufwand erfordert. Wie stark man von einer Behandlung profitiert, hängt von dem persönlichen Risiko für Folgeerkrankungen ab.
Quellen
Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS et al. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2020; (2): CD003177
Cai T, Abel L, Langford O et al. Associations between statins and adverse events in primary prevention of cardiovascular disease: systematic review with pairwise, network, and dose-response meta-analyses. BMJ 2021; 374: n1537.
Chou R, Cantor A, Dana T et al. Statin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. 2022.
Curfman G. Omega-3 Fatty Acids and Atrial Fibrillation. JAMA 2021; 325(11): 1063.
De Souza RJ, Mente A, Maroleanu A et al. Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ 2015; 351: h3978.
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention (S3-Leitlinie, in Überarbeitung). AWMF-Registernr.: 053-024. 2021.
Hooper L, Al-Khudairy L, Abdelhamid AS et al. Omega-6 fats for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2018; (11): CD011094.
Hooper L, Martin N, Jimoh OF et al. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2020; (8): CD011737.
Hu P, Dharmayat KI, Stevens CA et al. Prevalence of Familial Hypercholesterolemia Among the General Population and Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation 2020; 141(22): 1742-1759.
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Screening zur Früherkennung einer familiären Hypercholesterinämie bei Kindern und Jugendlichen: Rapid Report; Projektnr.: S24-01. 2024.
Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020; 41(1): 111-188.
Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L et al. The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012; 380(9841): 581-590.
National Cholesterol Education Program (NCEP). Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285(19): 2486-2497.
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Familial hypercholesterolaemia: identification and management (NICE Clinical Guidelines; No. 71). 2019.
Importante da sapere: I singoli articoli del blog dell’Istituto di Medicina Generale e Public Health di Bolzano non vengono aggiornati. Il contenuto si basa su ricerche e prove scientifiche disponibili al momento della pubblicazione. Le informazioni sanitarie online non possono sostituire un consulto medico personale. Le consigliamo di consultare il Suo Medico di Medicina Generale per eventuali problemi di salute. Ulteriori informazioni…